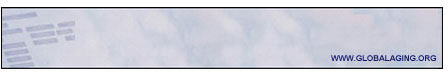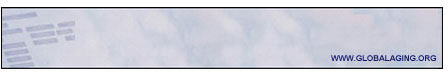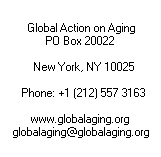
back
|
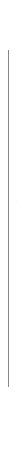 |
Das lange Sterben des Walter K.
Von: Martin Spiewak
Die Zeit, April 17, 2001
Wie der Wunsch nach einem würdigen Lebensende im Räderwerk von
Krankenhaus, Pflegeheim und Gerichten untergeht.
Im Zimmer riecht es nach Creme. Ein Radio spielt Klassik. Damit es
nicht so still ist. Kann Walter K. die Musik hören? Er liegt unter einer
Bettdecke, der Körper flach und hart wie ein Brett. Seine Fäuste stehen
im 90-Grad-Winkel von den Armen ab. Zwischen den Fingern steckt ein
Waschlappen, damit sich die Nägel nicht ins Fleisch graben. Die Nase ragt
nach oben, den zahnlosen Mund hat Walter K. aufgerissen. Ein weißer Pelz
bedeckt die Zunge. Mitunter stößt er röchelnd ein paar Laute aus. Wenn
das Röcheln zum Brodeln wird, weiß die Schwester, dass sie Schleim
absaugen muss.
Walter K.s Arme und Beine sind gelähmt, große Teile seines Gehirns sind
zerstört. Nur ab und zu öffnet er die Augen und lässt sie in
verschiedene Richtungen gleiten. Doch er atmet, und sein Herz schlägt
langsam und gleichmäßig.
Schaltet man das Radio ab, hört man das Pumpen, das Walter K. am Leben hält.
Über einen Schlauch drückt ein Motor Nahrung in seinen Körper. Eine
milchkaffeebraune Masse fließt aus einem Beutel durch ein Loch in der
Bauchdecke direkt in den Magen. Über einen zweiten Schlauch fließt Urin
aus der Blase ab. 12 Kartons der kaffeebraunen Sondernahrung stehen im
Schrank. Darüber liegen auf einem Bord fünf aufgeschnittene Polohemden.
Sie sind das Einzige, was Walter K. noch braucht. Der Bürokalender neben
dem Bett ist ohne Eintrag.
Walter K. hatte genaue Vorstellungen von den Dingen, den kleinen wie den
großen. "Man muss aus seinem Leben etwas machen" hieß einer
seiner Grundsätze. Eine gehobene Position in der Firma, 42 Ehejahre, vier
Kinder, ein Haus mit Garten - Walter K. hat aus seinem Leben etwas gemacht.
Als er vor fünf Jahren in Rente ging, wussten alle: Der bleibt jetzt
nicht zu Hause sitzen. Jeden Morgen um sechs stand er auf und fuhr vor dem
Frühstück mit seiner Frau zum Schwimmen. Zweimal im Jahr ging es in den
Urlaub. Australien, Südafrika, USA, stets ohne Reisegruppe, alles minutiös
geplant.
Ja, Walter K. war ein ordentlicher Mensch, der kluge Gedanken schätzte,
Gefühlen misstrauisch gegenüberstand und nur ungern etwas dem Zufall überließ,
im Leben wie im Sterben. Der Tod war ihm vertraut. Eine Freundin starb an
Parkinson, eine Schwägerin an Krebs, die Schwiegermutter lag in den
letzten Monaten ihres Sterbens im Koma. Seine eigene Mutter, ebenfalls von
Krebs zerfressen, verbrachte ihre letzten Wochen nicht im Krankenhaus,
sondern bei den K.s zu Hause.
Herr über seinen eigenen Tod zu sein, dieses Recht wollte auch Walter K.
für sich in Anspruch nehmen. Deshalb verfasste er am 19. Februar 1999
eine Patientenverfügung und setzte seine Unterschrift unter folgende Sätze:
"Für den Fall, dass ich unwiederbringlich nicht mehr in der Lage
sein sollte, meinen Willen auszudrücken, verfüge ich im jetzigen
Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, dass an mir keine sterbeverlängernden
Maßnahmen durchgeführt bzw. bereits begonnene abgebrochen werden, sofern
ich für den Rest meines Lebens unumkehrbar bewusstlos sein sollte."
So hatte er es in der ZEIT gelesen.
Der Fall ereignete sich schneller als gedacht. Sechs Wochen danach, im
Urlaub in Portugal, fand ihn seine Frau nachts auf dem Boden krabbeln und
sich übergeben. Das Hotelpersonal dachte, er sei betrunken. Kurze Zeit später
rührte er sich nicht mehr. Die Ärzte diagnostizierten eine
Bewusstlosigkeit als Folge einer Hirnhautentzündung.
Doch die Patientenverfügung hat Walter K. bis heute nichts genutzt. Drei
Prozesse wurden in der Sache K. geführt. Vier medizinische Gutachten
eingeholt. Walter K. aber darf nicht sterben.
Ehefrau Ellen K.
Am Anfang hatte sie noch Hoffnung. Ellen K. meinte, die deutschen
Mediziner könnten mehr erreichen als ihre portugiesischen Kollegen. Nach
ein paar Tagen nahm ihr ein Professor in der Universitätsklinik jede
Hoffnung. Im Stehen zwischen Tür und Angel hob er ein paar Abbildungen
des Gehirns ihres Mannes gegen das Licht, zeigte auf verschiedene dunkle
Areale und sagte: "Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt."
Walter K. leide unter einem apallischen Syndrom, auch Wachkoma genannt. Er
werde wohl niemals wieder aus seiner Bewusstlosigkeit erwachen.
In den ersten Tagen im Krankenhaus war noch von Rehabilitation die Rede
gewesen. Dann hieß es nur noch, man müsse ein Pflegeheim finden. Eine
Schwester warnte Frau K.: Geben Sie Ihren Mann nicht ins Heim, sagte sie,
Sie bekommen ihn nie wieder heraus. "Wir hörten nicht auf ihren Rat.
Das war unser größter Fehler."
Als Frau K. das Schreiben ihres Mannes vorlegte, sagten die Ärzte, es zähle
in diesem Fall nicht. Walter K. sterbe schließlich nicht, sondern brauche
nur künstliche Ernährung. Dafür bräuchten sie die Erlaubnis, eine
Magensonde legen zu dürfen. Und wenn ich mich weigere?, fragte Ellen K.
Dann wird er eben über die Nase ernährt, sagten die Ärzte. Das sei das
Gleiche. Die Antwort war falsch, aber Frau K. wusste es nicht und gab ihre
Unterschrift.
Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass sie sich übergangen, entmündigt,
bevormundet fühlte. Behandlungen ohne Zustimmung, falsche Abrechnungen,
nicht weitergegebene Arztbriefe. Vor kurzem wurde Herrn K. ein
Stoppelhaarschnitt verpasst, um das Haarewaschen zu erleichtern. "Er
hätte das nie gewollt", sagt sie. Und wenn er wüsste, wie
Schwestern ihm manchmal die Wange tätscheln, wie einem Kind, sagt sie und
schüttelt sich: "Er hätte sich geekelt."
Stets waren die K.s auf Unabhängigkeit bedacht, weder lagen sie jemals im
Krankenhaus noch standen sie vor Gericht. Doch nun musste Ellen K. erleben,
wie Ärzte, Pfleger, Richter über das Schicksal ihres Mannes entschieden
und seinen wichtigsten Wunsch ignorierten. "Er wollte nicht so
dahinvegetieren und hat das schriftlich bezeugt. Warum akzeptiert das
niemand? Wie ist das möglich in einem Rechtsstaat?"
Jeden zweiten Tag besucht Ellen K. ihren Mann im Heim. Sie streicht ihm
kurz über das Gesicht, schlägt die Decke zurück und schaut, ob er sich
durchgelegen hat. Dann geht sie wieder. Nicht ein Foto hat sie auf den
Nachttisch gestellt, statt Blumen steht Plastik in der Vase. Am Anfang
hatte sie ihm seine Musik vorgespielt: "Benny Goodman und solche
Sachen." Und ihr Parfüm mitgebracht. Doch er reagierte nicht, ebenso
wenig auf Rufen und Streicheln. Nun hält sie ihm manchmal kurz die Nase
zu, damit er wenigstens irgendetwas macht. Dann seufzt er auf.
Meist bleibt sie nur kurz, oft nicht länger als zehn oder zwanzig Minuten.
Eine Kontrollvisite, kein Besuch bei dem Mann, den sie geliebt, bewundert
hat und mit dem sie 40 Jahre lang das Leben teilte. Der ist irgendwann in
jenen Tagen nach dem 8. April 1999 in Portugal verschwunden.
Nur trauern kann sie nicht. Dafür wird sie bei jedem Besuch an seinen
letzten Wunsch erinnert. Wie einen lebenden Vorwurf sieht sie ihren Mann
dort liegen, der zu sagen scheint: "Du kannst meinen letzten Willen
nicht erfüllen." Mitunter fleht sie zurück: "Bitte höre auf
zu atmen."
Heimschwester S.
Zuerst habe sie Frau K.s Wunsch, dass ihr Mann sterben soll, nicht
verstanden, sagt Schwester S. Warum lässt sie ihren Mann nicht in Ruhe
weiterleben, habe sie gedacht, und genauso dächten noch immer viele im
Haus. Aber dann hat sie mit Frau K. gesprochen und sie verstanden. "Heute
wünsche ich es ihm, dass er sterben kann." Doch zu diesem Können dürfe
das Heim nichts beitragen. "Wir machen nur die Pflege."
Walter K. wird wie im Lehrbuch gepflegt. Er liegt auf einer beweglichen
Luftmatratze, die Druckstellen verhindern soll. Alle zwei Stunden kommt
eine Schwester ins Zimmer und legt ihn auf die andere Seite. Jedes
Umbetten bezeugt sie mit einer Unterschrift, damit sie es nicht vergisst.
Zweimal am Tag wird Walter K. gewaschen. Alle sieben Tage gebadet. Alle
drei Tage bekommt er ein neues Morphiumpflaster, dreimal am Tag Tee und SN,
Sondennahrung. So steht es auf einer Karteikarte, die an dem Pumpengerät
hängt. 6 Uhr SN, 10 Uhr Tee, 13 Uhr SN, 16 Uhr Tee, 19 Uhr SN, 22 Uhr
Tee. Dann ist der Tag vorbei.
Patientenverfügung - das Wort steht blau markiert auf Walter K.s Akte, für
jedermann gut sichtbar. Auch Heimbesitzerin M. hat eine solche Verfügung
geschrieben. "Wenn man das so sieht, dass die gar nichts zählt, wenn
man sterben will", sagt sie. "Das ist schlimm. Aber wir dürfen
nichts machen."
Zurzeit liegt eine alte Frau im Altenheim, die sich vorgenommen hat, zu
sterben, erzählt Schwester S. Sie isst nicht mehr und trinkt nicht mehr.
Man habe versucht, sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Vergeblich. Sie
wollte nicht mehr. Jetzt tupfen die Schwestern nur ab und zu den Mund
etwas feucht ab. "Wir respektieren ihren Willen."
Und wenn nun die Nachricht komme, auch Walter K. brauche nicht mehr ernährt
zu werden? "Dann können wir Herrn K. nicht hier behalten", sagt
Schwester S. und schüttelt den Kopf. Jeden Tag gehen die Schwester ins
Zimmer, waschen und betten ihn, und irgendwann heißt es, er soll
verhungern? Das gehe schließlich nicht sofort, dauert eine Woche,
vielleicht zwei. Aber es war doch sein Wille? "Ja, aber wir müssen
uns selbst schützen, wir haben auch eine Seele." Frau K. hätte ihn
gleich vom Krankenhaus nach Hause holen sollen. Aber nun, da er mal da ist
... "Wir sind nur die ausführenden Organe."
Hausärztin L.
"Herr K. kann noch viele Jahre leben", sagt die Hausärztin. Er
habe ein gutes Herz und einen stabilen Kreislauf. Vor ein paar Jahren hätte
ihm seine robuste Natur nur wenige Monate genutzt. Patienten im Koma
wurden mit einem Schlauch über die Nase ernährt. Zwangsläufig gerieten
Bakterien in den Körper, es kam zu Infektionen, Lungenentzündungen.
"Herr K. wäre längst tot."
Eine PEG-Sonde dagegen, wie sie Herr K. trägt, arbeitet keimfrei und
komplikationslos. Früher wurden die Sonden zur so genannten Percutanen
Endoskopischen Gastrostomie (PEG) nur im Krankenhaus eingesetzt. Heute
findet man PEG-Patienten in fast jedem Altenheim. Vor allem Demente lassen
sich per PEG nahezu problemlos ernähren. Über Jahre. Rund 100 000
Patienten bekamen 1999 eine PEG gelegt, mehr als die Hälfte ohne ihre
Einwilligung.
Für viele Wachkomapatienten bedeutet die Magensonde einen medizinischen
Fortschritt. Einige tausend Fälle zählt man in Deutschland, und vor
einigen Jahren dachte man noch, sie wären lebende Tote ohne Aussicht auf
Besserung. Heute weiß man es besser. In mühevoller Therapie - durch Berührungen,
Ansprache, Musik - versucht man mit den Apallikern Kontakt aufzunehmen.
Ihre Rehabilitation ist schwierig und dauert lange. Doch mitunter gelingt
es, sie Stück für Stück ins Leben zurückzuholen. Fortschritte sind vor
allem bei jungen Patienten möglich, die nach einem Unfall ins Koma
gefallen sind und sogleich behandelt werden. Solchen Kranken die PEG-Sonde
wegzunehmen, bezeichnen Angehörige und Ärzte daher auch als Mord.
Walter K. ist 70 und besitzt solche Chancen nicht mehr. Das hat das
Gutachten einer Rehaklinik für Wachkomapatienten bestätigt. Große Teile
seines Gehirns seien erloschen, die Augenbewegungen bloße Reflexe.
"Das Letzte, was wir ihm wünschen, wäre, dass sich sein Befinden
etwas verbessert, sodass er selbst merkt, in welchem Zustand er ist",
sagt der Neurologe.
Für Walter K. bedeutet die PEG-Sonde eine Verlängerung seines Sterbens.
Auf eine maschinelle Beatmung darf der Arzt verzichten, wenn sie nur das
Leiden verlängern würde. Eine künstliche Niere darf er abstellen, wenn
der Patient sterbenskrank ist und keine Besserung in Sicht ist. Denn
passive Sterbehilfe ist erlaubt und wird jeden Tag praktiziert. Die
Magensonde jedoch zählt laut den Richtlinien der Bundesärztekammer nicht
zur intensivmedizinischen Behandlung. Sie ist Hilfe zur Ernährung und gehört
damit zur Basispflege, wie Waschen oder Betten. Auf sie hat jeder Patient,
egal in welchem Zustand, ein Recht - und eine Pflicht.
"Wer die PEG abstellt, lässt den Patienten verhungern", sagt
die Hausärztin. Wenn Walter K. eine Lungenentzündung bekommt, könnte
sie darauf verzichten, Antibiotika zu geben. Wenn die PEG kaputt geht, würde
sie dafür kämpfen, dass keine neue gelegt wird. Wollte sie jedoch die künstliche
Ernährung abbrechen, hat sie Angst, sich strafbar zu machen. Was also müsste
geschehen? Frau K. müsste ihren Mann nach Hause holen, sagt die Ärztin.
"Stirbt Herr K. dort, würde ich einen Teufel tun, beim Ausstellen
des Totenscheins irgendwelche Zweifel aufkommen zu lassen."
Richterin N.
Einmal hat Frau K. es versucht. Im Herbst 1999 kündigte sie an, sie wolle
ihren Mann von jetzt an zu Hause pflegen. Da rief das Heim das Amtsgericht
an. Im Eilverfahren entzog die Richterin ihr die Betreuung für ihren
Mann. Es war die gleiche Richterin, die sich kurz zuvor geweigert hatte,
den Abbruch der künstlichen Ernährung zu genehmigen. "Wer gibt mir
das Recht, zu entscheiden, ob ein Mensch leben oder sterben soll?",
hat sich Richterin N. damals gefragt und, wie es sich für eine Richterin
gehört, ins Gesetz geschaut. Die Antwort, die sie fand, hieß: Niemand.
Andere Juristen sind zur gegenteiligen Meinung gekommen - zum Beispiel
jene des Bundesgerichtshofs. 1994 hatte der BGH im so genannten Kemptener
Urteil über einen ähnlichen Fall zu entscheiden. Ein Sohn wollte die künstliche
Ernährung seiner schwer hirngeschädigten Mutter einstellen lassen und
verständigte sich damals mit ihrem Arzt, der Frau nur noch Tee zu geben.
Der BGH hielt das Ansinnen für rechtmäßig.
Eine Behandlung dürfe auch dann abgebrochen werden, wenn der unmittelbare
Sterbevorgang noch nicht eingesetzt habe. Wichtig sei allein der Wille des
Patienten. Mit aktiver Sterbehilfe habe das nichts zu tun. Das BGH ging
noch einen Schritt weiter: Selbst wenn keine Patientenverfügung vorliege,
sei etwa ein Abbruch der Ernährung möglich, wenn der Patient zu
Lebzeiten Ähnliches geäußert habe. Zu prüfen habe dies das Gericht,
das auch sonst für Vormundschaftsfragen zuständig ist, in der Regel das
Amtsgericht eben.
Das Urteil und seine Begründung waren ein Fanal im ewigen Streit zwischen
Selbstbestimmungsrecht des Patienten und dem unbedingten Wert des Lebens.
In der Praxis jedoch änderte sich nichts. Bis heute hat nur das
Amtsgericht Oberhausen ein einziges Mal den Abbruch einer künstlichen Ernährung
genehmigt. In allen anderen Fällen verhielten sich die Richter wie
Amtsrichterin N.: Sie erklärten sich für nicht zuständig. "Es ist
nicht die Aufgabe des Gerichts, die letzte Schranke zu lösen."
Eine Rechtslücke also, die es im Interesse der Betroffenen zu schließen
gilt, möchte man meinen. Doch davon will man beim zuständigen
Ministerium in Berlin nichts wissen. Patienten hätten bereits heute das
Verfügungsrecht über die letzte Phase ihres Lebens, sagt
Justizministerin Herta Däubler-Gmelin. Was das Gesetz regeln müsste, sei
geregelt. Die unausgesprochene Angst lautet: Jede Bestimmung, die explizit
klärt, wer unter welchen Umständen über das Ende eines Lebens bestimmen
darf, wäre ein Schritt in Richtung Holland.
Gerichte, die nicht selbst die Entscheidung treffen müssen, sagen, man
darf entscheiden; Gerichte, die entscheiden müssten, entgegnen, man dürfe
es nicht; und die Politik behauptet, es gebe keine Probleme. Diese
gegenseitige Blockade der Rechtsorgane scheint der Amtsrichterin N. jedoch
nicht unrecht zu sein. Denn niemals könne man mit Sicherheit wissen, was
Patienten wie Herr K. wirklich wollten. Als er die Patientenverfügung
ausfüllte, sei er schließlich gesund gewesen. Außerdem lässt Walter
K.s letzter Wille Raum für Interpretationen. Was heißt "sterbeverlängernde
Maßnahmen"? Was meint er genau mit "unumkehrbar bewusstlos"?
Die PEG-Sonde wird in der Verfügung nicht erwähnt. "Vielleicht
denkt er heute ganz anders darüber, vielleicht ist er ja glücklich",
sagt Richterin N.
Wenn Frau K. solche Sätze hört, hasst sie die Richterin.
Anwalt R.
Er hat den Fall Walter K. zur persönlichen Sache gemacht. Er hat
medizinische Fachbücher gekauft, englische Aufsätze zu den Fortschritten
der Neuromedizin kopiert. "Man sieht sich ja immer selbst da liegen",
sagt Anwalt R. "Oder die Mutter oder den Vater."
Zwei vergebliche Verfahren hat er in der Sache K. angestrengt, erst vor
dem Amtsgericht, dann vor dem Landgericht, das die Entscheidung der
Richterin N. bestätigte. Er könnte in die nächsten Instanzen gehen,
dort vielleicht ein Urteil erwirken, das beispielhaft ist und die
Rechtsunklarheit beendet. Doch das hieße erneute Prüfungen, Anhörungen
und Befragungen, weitere Gutachten. Zudem würde es bis zur Entscheidung
Jahre dauern - ohne Garantie, dass die Richter in seinem Sinn entscheiden.
"Wie Mediziner sind viele Richter verantwortungsscheu."
Rechtsanwalt R. weiß das recht gut, denn er war 30 Jahre lang selbst
einer.
Einen neuen Prozess will er Frau K. nicht zumuten. Stattdessen hofft er,
die Sache "unauffällig zu lösen". Denn das Landgericht hat
zwar das Urteil der Richterin N. bestätigt, Frau K. jedoch wieder als
Betreuerin eingesetzt. Sie sei am besten geeignet zu erwägen, heißt es
in der Urteilsbegründung, ob es dem Willen ihres Mannes entspricht, die
"künstliche Ernährung mittels Nahrungssonde einzustellen und ihn
verhungern zu lassen." Ein Wink: Wir Richter können nicht
entscheiden, die Ehefrau vielleicht. Anwalt R. hat sich erkundigt, wie so
etwas in den meisten Fällen funktioniert. Die Ernährung wird langsam zurückgefahren,
die Dosis Schmerzmittel erhöht. Nur ein Arzt muss mitspielen.
Vor kurzem wurde ein solcher Fall von dem Anwalt Wolfgang Putz erfolgreich
durchgefochten. Ein Arzt hatte einer auf 26 Kilo abgemagerten Frau nach
sechs Jahren Koma die PEG entfernt - im Einverständnis mit Angehörigen
und Pflegeheim. Medikamente stellten die Frau schmerzfrei, nach sieben
Tagen starb sie. Noch am Todestag erfolgte eine anonyme Anzeige. Doch die
Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Es habe sich nicht um eine Tötung
gehandelt, so die Staatsanwaltschaft. Der Arzt habe nur dem Willen der
Patientin entsprochen. Sein Handeln war nicht nur erlaubt, sondern geboten.
"Wir dürfen nicht fragen, ob wir aufhören dürfen, wir müssen
fragen, ob wir weitermachen dürfen." So hat der Jurist Jochen
Taupitz die Rechtslage auf dem Deutschen Juristentag des vergangenen
Jahres zusammengefasst.
Die Debatte, ob man holländische Verhältnisse auch in Deutschland
brauche, halten Juristen wie Putz daher für überflüssig. Die
Palliativmedizin und das deutsche Recht böten für alle denkbaren Fälle
ethisch vertretbare Lösungen. Nur wissen es die wenigsten Ärzte, Pfleger,
Patienten und Angehörigen - oder es fehlt ihnen der Mut.
Auch Frau K. hat Angst und die Hausärztin ebenso. "Wir werden
beobachtet", sagt sie. Jemand könnte sie anzeigen. Eine Untersuchung
würde folgen, eventuell ein Prozess. "Das stimmt", sagt Anwalt
R. "Doch wahrscheinlich würde sie freigesprochen." Sicher wäre:
Walter K. hätte seinen Willen.
|